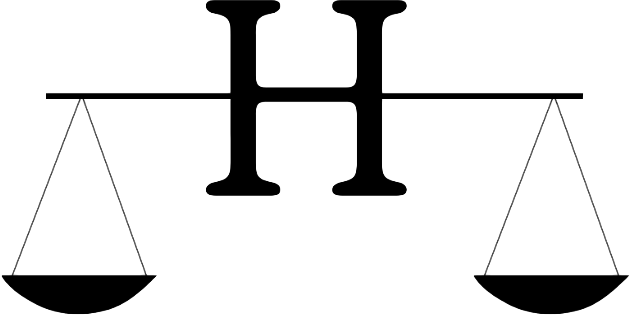Bei Kryptowährungen handelt es sich um digitale oder virtuelle Währungen, die auf kryptographischen Prinzipien basieren. Diese Währungsarten verwenden Verschlüsselungstechniken, um Transaktionen zu sichern und die Erzeugung neuer Einheiten zu kontrollieren.
Die weltweit bekannteste und erste Kryptowährung ist Bitcoin, die im Jahr 2009 eingeführt wurde. Die Währung Bitcoin ermöglicht Peer-to-Peer-Transaktionen ohne sog. Zwischenhändler wie Banken. Bitcoin verwendet eine dezentrale Datenbank, die als sog. Blockchain bezeichnet wird, um finanzielle Transaktionen zu verfolgen und zu überprüfen.
Es gibt darüberhinaus mittlerweile viele andere Kryptowährungen wie z.B. Ethereum, Ripple und Litecoin. Jede einzelne dieser Währungen hat eigene Merkmale und – teilweise – spezielle Anwendungsfälle. Zum Beispiel ermöglicht Ethereum die Entwicklung von Smart Contracts, während Ripple darauf abzielt, grenzüberschreitende Zahlungen für die Nutzerinnen und Nutzer effizienter zu gestalten.
Kryptowährungen bieten diverse Vorteile. So ermöglichen sie schnelle und kostengünstige Transaktionen, Sicherheit durch Verschlüsselung und Unabhängigkeit von zentralen Behörden. Der Nutzung wohnen jedoch auch durchaus Risiken inne, wie in etwa die hohe Volatilität der Preise und potenzielle Sicherheitslücken in den verwendeten Technologien.
Um Kryptowährungen zu nutzen, benötigt man eine digitale Geldbörse (sog. Wallet), in der man die jeweilige Währung speichern kann. Man kann die Währung entweder durch den Kauf auf Krypto-Börsen erwerben oder durch das sogenannte Mining verdienen, bei dem man Rechenleistung zur Verfügung stellt, um Transaktionen zu verifizieren.
In den letzten Jahren haben Kryptowährungen weltweit an Popularität gewonnen und werden von immer mehr Menschen und Unternehmen akzeptiert. Die Währungen haben das Potenzial, die Art und Weise, wie die Menschen Geld übertragen und speichern, zu verändern. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass der Kryptowährungsmarkt volatil ist und es Risiken gibt, insbesondere für unerfahrene Anleger.
Was sind die Zusammenhänge, die einen Strafverteidiger im Zusammenhang mit Kryptowährungen immer wieder begegnen?
Insbesondere die Frage der Besteuerung ist hier von Bedeutung. Der Bundesfinanzhof hat im Februar diesen Jahres die Steuerpflicht der Veräußerungsgewinne aus Bitcoin, Ethereum und Monero bejaht.
Veräußerungsgewinne, die ein Steuerpflichtiger innerhalb eines Jahres aus dem Verkauf oder dem Tausch von Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und Monero erzielt, unterfallen der Besteuerung als privates Veräußerungsgeschäft. Dies hat der Bundesfinanzhof mit Urteil vom 14.02.2023 – IX R 3/22 – entschieden.
Bei Kryptowährungen handelt es sich dem Bundesfinanzhof zufolge um Wirtschaftsgüter, die bei einer Anschaffung und Veräußerung innerhalb eines Jahres der Besteuerung als privates Veräußerungsgeschäft nach § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Einkommensteuergesetzes (EStG) unterfallen.
Virtuelle Währungen (Currency Token, Payment Token) stellen nach Auffassung des Bundesfinanzhof ein „anderes Wirtschaftsgut“ i. S. von § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG dar. Erfolgen Anschaffung und Veräußerung oder Tausch der Token innerhalb eines Jahres, unterfallen daraus erzielte Gewinne oder Verluste der Besteuerung.
Der Bundesfinanzhof hat in seinem Urteil ebenfalls bestätigt, dass es sich bei einem Swap innerhalb der Haltefrist, genauso wie bei einem Verkauf von Kryptowährungen, um einen steuerpflichtigen Vorgang handelt. Der Begriff des Wirtschaftsguts sei weit zu fassen. Der Begriff umfasse neben Sachen und Rechten auch tatsächliche Zustände sowie konkrete Möglichkeiten und Vorteile, deren Erlangung sich ein Steuerpflichtiger etwas kosten lässt und die nach der Verkehrsauffassung einer gesonderten selbstständigen Bewertung zugänglich sein. Nach dem Urteil des Bundesfinanzhof sind bei virtuellen Währungen eben diese Merkmale gegeben. Bitcoin, Ethereum und Monero sind wirtschaftlich betrachtet als eigenständiges Zahlungsmittel anzusehen; mit Ihnen wird gehandelt an der Börse und anderen Plattformen, ihnen wohnt ein eigener Kurswert inne und sie werden zu konkreten Zahlungsabwicklungen genutzt.
Ein sog. strukturelles Vollzugsdefizit steht nach Ansicht des Bundesfinanzhofes einer Besteuerung nicht entgegen. Denn weder bestehen gegenläufige Erhebungsregelungen, noch liegen Anhaltspunkte dafür vor, dass seitens der Finanzverwaltung Gewinne und Verluste aus Geschäften mit Kryptowährungen nicht ermittelt und erfasst werden können. Dass es in Einzelfällen Steuerpflichtigen beim Handel mit Kryptowährungen gelinge, sich der Besteuerung durch den Staat zu entziehen, könne ein strukturelles Vollzugsdefizit nicht begründen.
Wie erlangt das Finanzamt Kenntnis Gewinnen aus Bitcoin und anderen Kryptowährungen?
Eine Möglichkeit ist die Datenweitergabe von den jeweiligen Börsen, so wie bei bitcoin.de in Deutschland. Eine weitere Möglichkeit ist die Meldung von Banken im Rahmen von Vorsichtsmaßnahmen zur Geldwäscheprävention. Hierzu erfolgen bei Einzahlungen und Überweisungen auf die Bankkonten bei den klassischen Bankunternehmen schnell Meldungen an die zuständigen Staatsanwaltschaften, die so dann die Ermittlungsansätze prüfen. Es erfolgen Einsichtnahmen in die Blockchains, wodurch die jeweiligen Coins bis zur Entstehung lückenlos zurückverfolgt werden können. Danach werden dann die Halter identifiziert. Dies erfolgt in der Regel durch das Anfragen von Kundendaten (etwa bei bitcoin.de), oder durch zu stellende Sammelauskunftsersuchen an die genutzten Handels- oder Vermittlungsplattformen (§ 93 Abs. 1a AO).
Sollte die Ermittlungsbehörde, grds. die Bußgeld- und Satrafsachenstelle des Finanzamtes, einen Anfangsverdacht wegen des Straftatbestands der Steuerhinterziehung gem. § 370 Abgabenordnung (AO) bejahen, werden weitere Ermittlungen angestellt und oder direkt Anklage erhoben. Eine Steuerhinterziehung liegt dann vor, wenn der Betroffene die erzielten Gewinne, die die jährliche Freigrenze überschreiten, bei der Steuererklärung nicht angibt oder die einzelnen Posten verfälscht hat. Es sollte dann zwingend durch Ihren Rechtsanwalt juristisch geprüft werden, ob die Annahmen der Ermittlungsbehörde zutreffend sind.
Wichtig im Vorhinein ist zu beachten: Sollten in der Steuererklärung Angaben zu den Daten und Werten von Kauf, Verkauf und oder swaps gänzlich fehlen, wird das Finanzamt in der Regel hierzu äußerst großzügige Schätzungen zu ihrem Nachteil vornehmen.
Gemäß § 370 AO wird der verwirklichte Tatbestand der Steuerhinterziehung mit Geldstrafen oder Freiheitsstrafen von bis zu fünf Jahren bestraft. Es hängt von den Umständen des Einzelfalles ab, wie die Straferwartung einzuschätzen ist. Nicht zu vergessen ist, dass der Betroffene die Rückzahlung der hinterzogenen Steuern samt Zinsen plus Verspätungsaufschlag leisten muss.
Ihr Strafverteidiger wird prüfen, ob eine Selbstanzeige noch zeitlich in Betracht kommt. Diese wirkt nur dann strafbefreiend, wenn sie noch vor Bearbeitung der Steuererklärung durch die Finanzbehörde eingeht, und alle fehlenden (vollständigen und richtigen) Angaben enthält. Sollte eine Selbstanzeige rechtzeitig eingehen und akzeptiert werden sind Sie lediglich die hinterzogenen Steuern samt Zinsen nachzuzahlen.
Sollte Ihnen hingegen bekannt sein (oder vermuten Sie dies) dass gegen Sie Ermittlungen durch Polizei und Staatsanwaltschaft gegen Sie erfolgen, ist von einer Einlassung ohne anwaltliche Beratung grundsätzlich abzuraten.
Zum Inhalt springen