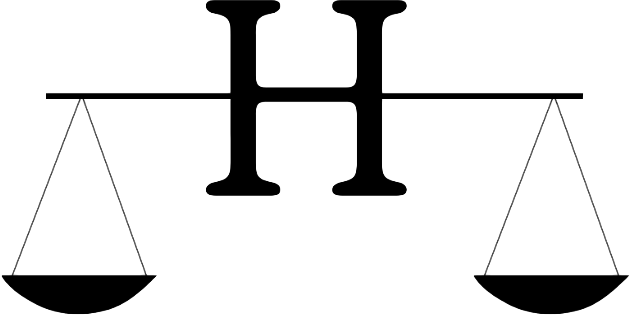Seit der ersten EU-Geldwäscherichtlinie aus dem Jahr 1991 hat sich die Regulierung der Geldwäschebekämpfung kontinuierlich weiterentwickelt – mit zahlreichen Verschärfungen auf nationaler und europäischer Ebene.
Ein großer Schritt steht mit dem aktuellen EU-Geldwäschepaket bevor. Es umfasst eine neue Geldwäscheverordnung (AML-VO), die sechste Geldwäscherichtlinie, die Einrichtung einer EU-Behörde zur Geldwäscheaufsicht (AMLA) sowie die Aktualisierung der Geldtransferverordnung. Ziel ist ein einheitliches Regelwerk („Single Rulebook“) für die gesamte EU, das u.a. Kryptodienstleister und Fußballvereine einbezieht, die Höchstgrenze für Barzahlungen senkt und die Identifizierung von wirtschaftlich Berechtigten verschärft. Für Unternehmen bedeutet das neue Regelwerk erheblichen Anpassungsaufwand – von strengeren Kundenprüfungen bis zu neuen Meldepflichten. Die AMLA wird zudem die nationalen Aufsichtsbehörden koordinieren und selbst direkt Finanzsektorakteure überwachen.
Parallel plant Deutschland mit dem Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz (FKBG) die Gründung eines Bundesamts zur Bekämpfung von Finanzkriminalität (BBF), um die bisher fragmentierte Aufsicht zu bündeln und die Zusammenarbeit von Behörden zu verbessern.
Die Tatsache, dass Deutschland als „Geldwäsche-Paradies“ gilt, erhöht den Druck, insbesondere hierzulande die gesetzliche Aufsicht zu verschärfen. Für deutsche Banken und Unternehmen bedeutet dies nicht nur eine strengere Kontrolle, sondern auch eine erhöhte Haftungs- und Sorgfaltspflicht bei der Einhaltung der Anti-Geldwäsche-Vorschriften. Aus anwaltlicher Perspektive ist eine proaktive und umfassende Compliance-Beratung unerlässlich, um rechtliche Risiken zu minimieren und den Anforderungen der neuen Aufsichtsbehörde gerecht zu werden.
Die Entscheidung, Frankfurt am Main zum Sitz der neu geschaffenen europäischen Anti-Geldwäsche-Behörde, der sogenannten Anti-Money Laundering Authority (AMLA), zu ernennen, markiert einen zu beachtenden wichtigen Schritt in der Bekämpfung grenzüberschreitender Finanzkriminalität. Aus anwaltlicher Sicht ist dies ein Signal für die Intensivierung der Ermittlungsbemühungen und der angestrebten Harmonisierung der Geldwäscheprävention innerhalb der EU.
Aktuell bestehen in Europa 27 unterschiedliche Systeme zur Geldwäschebekämpfung, was erhebliche regulatorische Lücken aufzeigt. Die Amla soll diese Fragmentierung überwinden und ein einheitliches, schlagkräftiges System etablieren. Für Unternehmen und Finanzinstitute bedeutet dies, dass Compliance-Anforderungen künftig strenger und standardisierter durchgesetzt werden – eine Entwicklung, die Rechtsberatung in den Bereichen Finanzregulierung und Strafrecht weiter intensivieren und noch bedeutender machen wird. Eine frühzeitige Auseinandersetzung mit den neusten Regulatorien ist nicht nur aus anwaltlicher Sicht zwingend geboten.
Die AMLA wird künftig unmittelbar rund 40 grenzüberschreitend tätige Banken mit erhöhtem Geldwäscherisiko beaufsichtigen und gleichzeitig nationale Aufsichtsbehörden koordinieren. Besonders hervorzuheben ist dabei die Ausweitung der Zuständigkeit auf Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen, ein Bereich, der aufgrund seiner Komplexität und Innovationsdynamik zunehmend im Fokus regulatorischer Maßnahmen steht.
Abschließend lässt sich festhalten, dass die AMLA nicht nur ein Instrument der EU zur Bekämpfung von Geldwäsche ist, sondern auch ein Motor für die Vereinheitlichung und Verschärfung der europäischen Finanzregulierung. Für Unternehmen und Rechtsberatende bedeutet dies, sich frühzeitig und umfassend mit den neuen Rahmenbedingungen auseinanderzusetzen, um rechtliche Sicherheit und regulatorische Compliance sicherzustellen.